|
|
Positiver
Effekt der Thermobehandlung der Basaltschmelze auf die Qualität der
Mineralwolle
Die Schmelzung der Basaltladung ist einer
der wichtigsten Bestandteile im Produktionsprozess von Produkten aus Steinwolle,
da die Qualität des Schmelzens im Wesentlichen die Eigenschaften der
resultierenden Fasern und auch die Qualität des Endproduktes bestimmt.
Die Qualität der Mineralwolle kann mit
folgenden Eigenschaften beschrieben werden:
·
Dicke der Fasern,
·
Länge der Fasern,
·
Elastizität der Fasern,
·
chemische Stabilität der Fasern,
·
Vorhandensein von nicht-faserigen
Formationen kristalliner
Struktur (sog. Perlen),
·
Wasserbeständigkeit.
In einer Reihe von Experimenten wurde
festgestellt, dass die im Ofen erreichte Temperatur die Zähflüssigkeit der
Schmelze und damit die Dicke und Länge der Faser bestimmt. Diese Eingeschalten
beeinflussen wiederum die Grundeigenschaften des fertigen Materials
(Wärmeleitfähigkeit, Festigkeit). Die durchgeführten Studien zu diesem Thema
haben bereits die optimale Temperatur der Schmelze an der Zentrifuge definiert.
Diese soll im Bereich 1420 – 1490 °C liegen (2). Bei genannter Temperatur erhält die Schmelze eine optimale
Viskosität, und die Mineralfaser erhalten dadurch ihre amorphe Struktur, die
erforderliche Elastizität und die optimalen geometrischen Abmessungen (Dicke
und Länge).
Eine weitere wichtige Eigenschaft der
Mineralwolle ist das Vorhandensein (oder genauer, die Abwesenheit) von
nicht-faserigen kristallinen Formationen. Häufig beinhaltet die fertige
Mineralwolle außer der amorphen Mineralfasern auch einen bestimmten Anteil von
kugelförmigen Formationen
kristalliner
Struktur, sogenannten „Perlen“. Diese Partikeln stellen praktisch die
"Brücken" für die Wärmeübertragung dar und erhöhen dadurch die
Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle. Aus diesem Grund sollte der Anteil von
diesen Partikeln in der Mineralwolle soweit möglich minimiert werden.
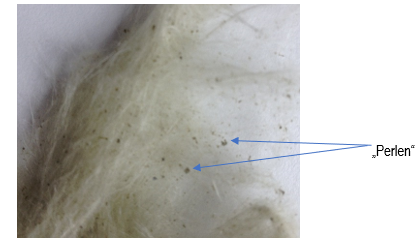
Abbildung 1: Nicht-faserige Formationen kristalliner
Struktur (sog. Perlen) in der Mineralwolle aus Basalt
Für die entsprechende Problemlösung ist
es wichtig, zuerst die Ursachen des Entstehens dieser Formationen zu verstehen.
Hier scheint die Frage relevant zu sein: Warum wird bei gleicher chemischer
Zusammensetzung und bei gleicher Gusstemperatur ein Teil der Schmelze zu Fasern
gezogen, ein Teil jedoch in der Form von sog. „Perlen“ verbleibt?
Die Antwort liegt in der Ausbildung der
Mikrostruktur, im Vorhandensein von schwer schmelzbaren Phasen und besonders in
lokalen Anhäufungen dieser Phasen. Unter einer Phase wird hier ein
thermodynamisch homogenes Teil eines Systems verstanden. In einem
Mehrkomponentensystem können Phasen unterschiedliche Zusammensetzung und
Struktur aufweisen. Im Laufe der Untersuchungen der Eigenschaften der
Basaltschmelze wurde u.a. die Phasenanalyse
erstellt sowie die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Phasen
definiert. Es wurde dabei festgestellt, dass das Gefüge vom untersuchten Basalt
aus 6 Phasen besteht (1).
Während der Untersuchung wurden die auftretenden Veränderungen während des
Schmelzens des Rohstoffes und des Erhitzens der resultierenden Silikatschmelze beobachtet. So waren bis zu einer
Temperatur von 1200 °C hauptsächlich kristalline Phasen vorhanden. Es wurde
auch beobachtet, dass die Probe, die 1 Stunde lang bei 1200 °C behandelt wurde,
stark kristallisierte Phasen enthielt. Die stabilsten Phasen (jene Phasen, die
einen höheren Schmelzpunkt besitzen) im untersuchten Basalt-Rohstoff waren die
Phasen auf der Basis von Eisenverbindungen (Magnetit und Hämatit).
Darüber hinaus existieren bereits
Studien, die den Einfluss von Schmelztemperaturen auf die Struktur und
physikalisch-chemische Parameter der Basaltschmelze feststellen (3). Bei diesen Untersuchungen wurden Tests mit
unterschiedlich hergestelltem Basaltglas durchgeführt. Es wurde festgestellt,
dass das bei 2000ºC hergestellte Basaltglas deutlich weniger für
Kristallisation anfällig ist. Dies liegt daran, dass bei hohen Temperaturen das
Kristallgitter des Materials intensiver zerstört wird und weniger Zonen mit
einer geordneten Struktur verbleiben (3).
Weiter wurde im Rahmen der gleichen Studie ein Zusammenhang zwischen der
Schmelztemperatur (thermischer Behandlung der Schmelze) und Faserqualität nachgewiesen.
Insbesondere wurde belegt, dass die Fasern aus homogenen
Hochtemperaturschmelzen (2000 °C) keine nicht-geschmolzenen Ladungsteilchen,
Quarzeinschlüsse und Gasblasen enthalten und eine praktisch defektfreie
Oberfläche aufweisen (3). Dies bedeutet, dass bei thermischer
Behandlung der Schmelze, erstens, die Gleichmäßigkeit der Eigenschaften der
Fasern und zweitens, die Minimierung der nicht-faserigen kugelförmigen
Formationen kristalliner Struktur (der sog. Perlen) auftritt.
Das heißt, dass um die Qualität der
Schmelze zu gewährleisten, sollten in einer Schmelzanlage unterschiedliche
thermische Zonen vorhanden sein: erstens, die Schmelzzone (die Schmelzung des
Basaltgesteines erfolgt schon bei einer Temperatur von ca. 1200°C); zweitens, die
Zone der nachfolgenden Erhitzung auf eine Temperatur von ca. 1700 – 1750°C (um
die homogene Phase der Schmelze zu erhalten) und drittens, die Zone der
Abkühlung auf eine Temperatur von ca.1450 – 1490°C (Temperatur der optimalen
Viskosität am Spinner). Es handelt sich dabei um unterschiedliche Vorgänge, deren
Durchführung in einem herkömmlichen Ofen (ganz egal, ob in einem koksbetriebenen
Kupolofen, Gasofen oder Elektroofen) prinzipiell nicht möglich ist. Um den
durchgehenden Prozess mit den o.g. thermischen Vorgängen zu gestalten, ist eine
rohrförmige Schmelzvorrichtung, aufgeteilt auf thermische Zonen, notwendig.
Angesichts der oben genannten Tatsachen
und Erwägungen können die neuen technologischen Lösungen in der Anwendung der induktiven,
konduktiven oder kombinierten Schmelztechnologien gefunden werden.
Literatur:
[1] IB Ingineering GmbH: Eigenschaften der Basaltschmelze, Teil 1; http://www.ibe.at/wp-content/uploads/2018/04/Eigenschaften-der-Basaltschmelze.pdf
[2] IB Ingineering GmbH: Eigenschaften der Basaltschmelze, Teil 2;
[3] N.N. Khodakowa, O.S. Tatarintseva, V.V. Samoilenko: Einfluss der Bedingungen für die Gewinnung von Basaltglas auf ihre Struktur und Eigenschaften, Polzunovskij Vestnik Nr. 4, T. 2, 2014; online abrufbar unter http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2014_04_2/pdf/148hodakova.pdf
